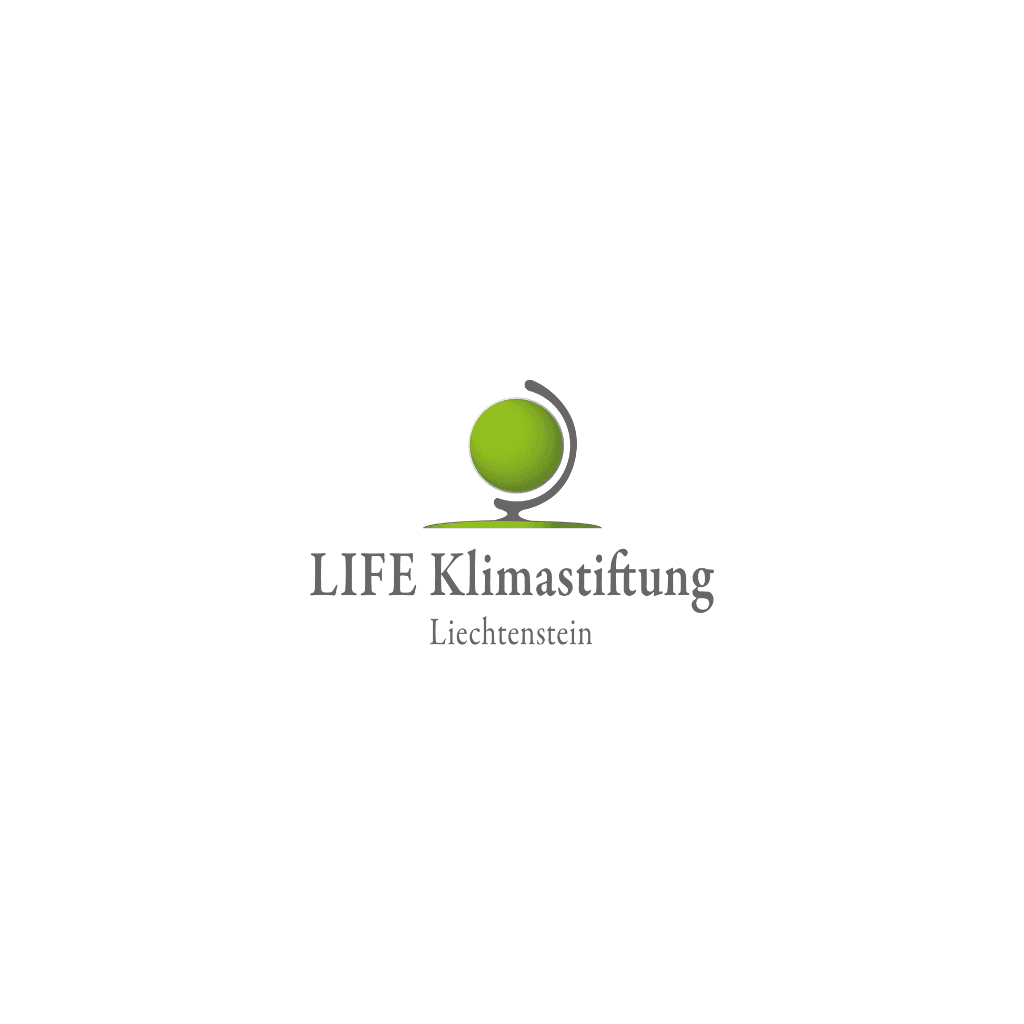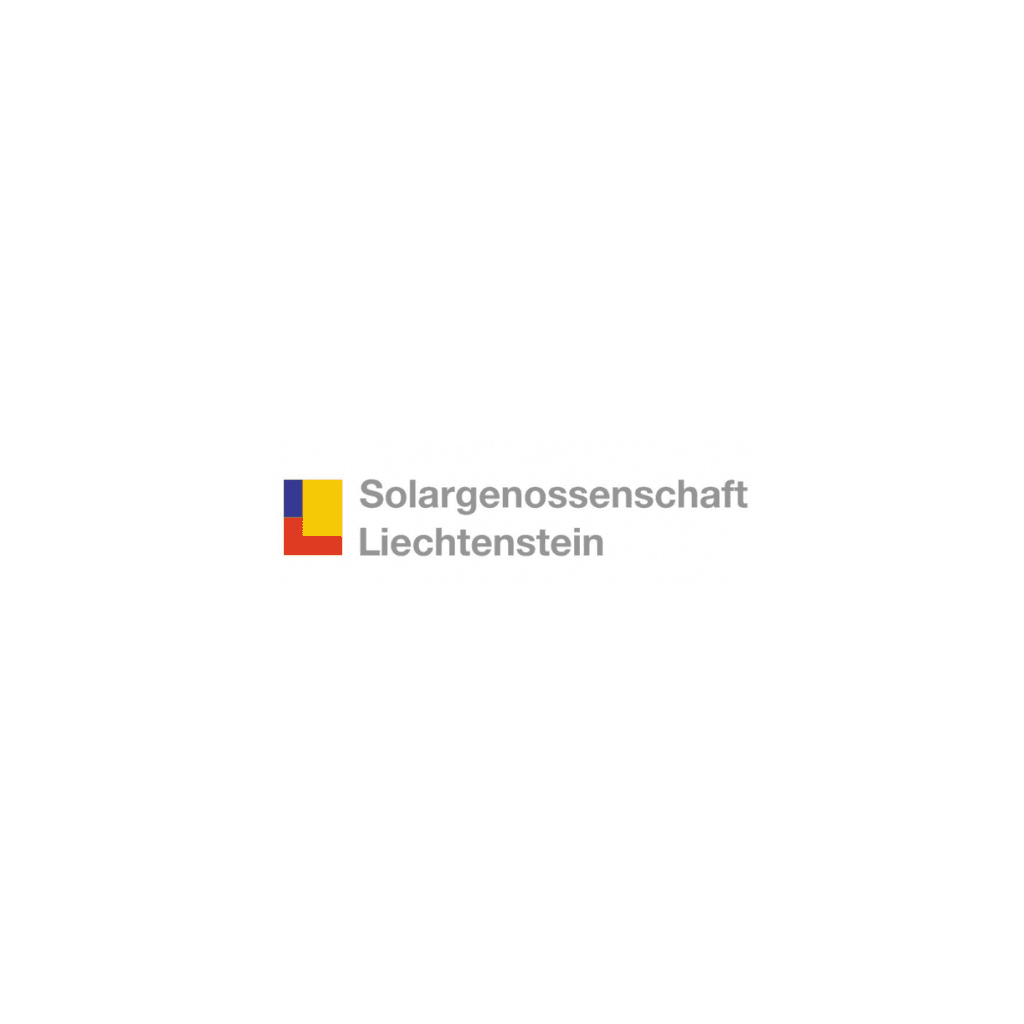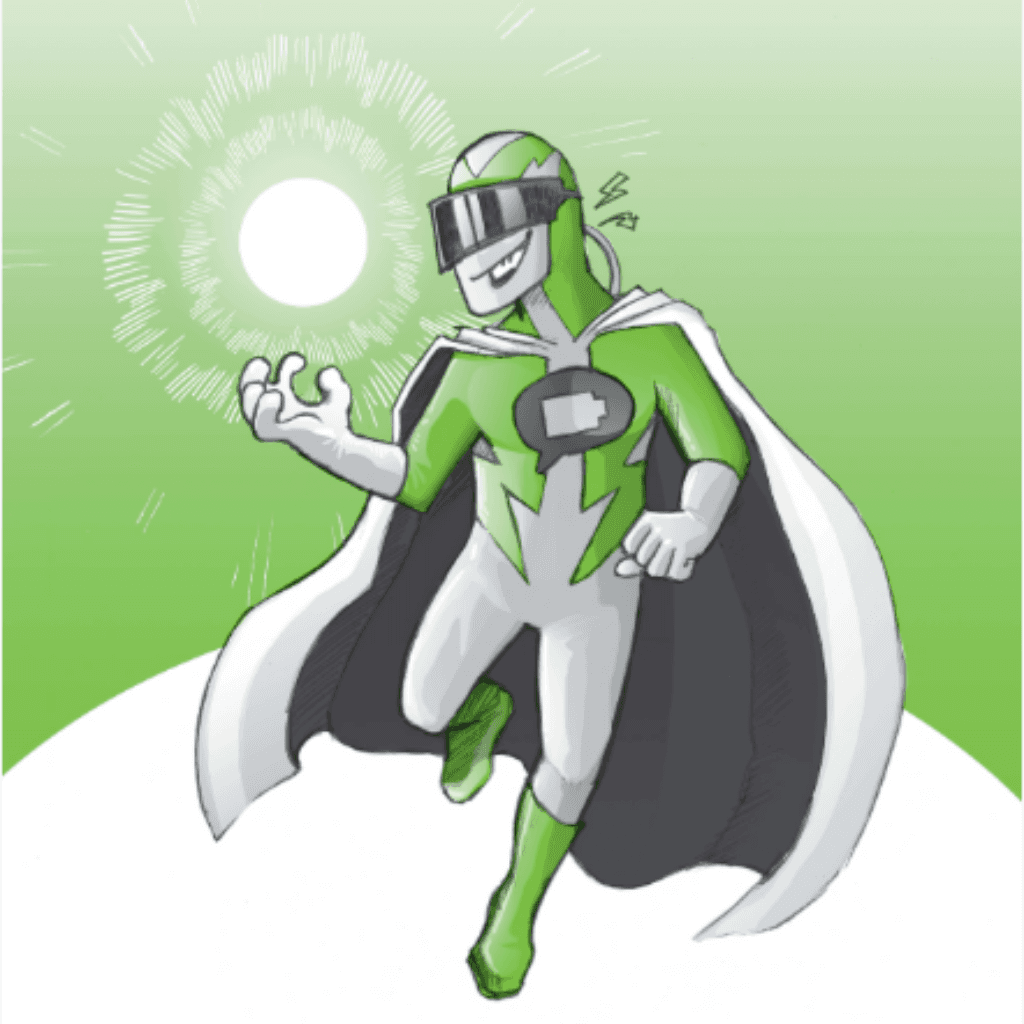Energie
Die Energiegewinnung, -umwandlung und -nutzung beeinflussen das tägliche Leben oft unbemerkt. Die Durchdringung sämtlicher Aktivitäten mit Energie hat neben Vorteilen auch Nachteile wie die steigende Abhängigkeit von erschwinglicher Energie und kritischen Infrastrukturen sowie die negativen Auswirkungen der Bereitstellung der Energieträger sowie deren Einsatzes auf die Umwelt. Ein Grossteil des weltweiten Wirtschaftswachstums der letzten 150 Jahre basierte auf fossilen Energieträgern.
Wie ist die aktuelle Situation?
Global werden aktuell über 600 Exajoule (EJ) bzw. 167 Bio. Kilowattstunden (kWh) Primärenergie genutzt.
Alleine China verbraucht 170 EJ und die USA 95 EJ.
Zum Vergleich dazu entspricht 1 EJ etwa dem aktuellen Primärenergieverbrauch von Portugal oder Belarus.
Liechtenstein bezieht aktuell ca. 85% der Energie aus dem Ausland.
Ein Drittel davon ist Elektrizität aus Wasser, Sonne, Wind, Kernenergie und «Nicht überprüfbaren Energien».
Der Grossteil sind fossile Energieträger wie Erdgas, Heizöl, Benzin und Diesel.
Nur 90 EJ von den global genutzten 600 EJ stammen aus erneuerbaren Quellen.
2023 lag der Energieverbrauch pro Einwohnerin und Einwohner in Liechtenstein bei 28,7 MWh.
Im Vergleich zu den Nachbarländern liegt Liechtenstein in der Mitte.
Österreichs Pro-Kopf-Verbrauch war mit 31,0 MWh am höchsten und in der Schweiz mit 23,8 MWh am niedrigsten.
Im Jahr 2023 wurden in Liechtenstein 170 GWh Energie aus einheimischen Quellen erzeugt. Das entspricht 0.000612 EJ und sind fast 12% mehr als im Vorjahr.
Aus Wasserkraft erzeugter Strom macht dabei fast die Hälfte aus und Strom von Photovoltaikanlagen über ein Viertel.
Seit 1980 hat sich der Gesamtverbrauch mehr als verdoppelt.
Erdöl macht mit einem Drittel den grössten Anteil aus, gefolgt von Kohle und Erdgas.
Die Nachfrage nach fossilen Energieträgern steigt immer noch stetig.
Die Wärmeproduktion aus einheimischem Brennholz, Biogas und thermischen Sonnenkollektoranlagen betrug knapp 50 GWh.
In Europa beträgt der Primärenergieverbrauch etwa 80 EJ.
Erdöl ist mit einem Drittel der häufigste Energieträger, gefolgt von erneuerbaren Energien und Erdgas.
Kohle und Atomenergie mit je ca. 8% bilden das Schlusslicht.
Die Eigenversorgungsquote für Energie aus einheimischen Ressourcen liegt bei 15%, jene rein für Elektrizität bei 30%. Das bedeutet, dass Liechtenstein selbst so viel Strom produziert, um 30% des Stromverbrauchs im Land abzudecken.
Wenn man jedoch den gesamten Energiebedarf des Landes betrachtet, produziert Liechtenstein nur so viel Strom und Wärme, dass 15% des Gesamtbedarfs abgedeckt werden.
Die Energie für den restlichen Bedarf muss importiert werden.
2023 stammten ca. 62% der einheimischen Stromproduktion aus Wasserkraft.
Wasserkraft ist bis auf kleinere Modernisierungen und das Potenzial am Rhein nahezu ausgeschöpft. Das Potenzial des Rheins wird derzeit aus wirtschaftlichen, aber auch aus umweltpolitischen Gründen nicht weiterverfolgt.
Ca. 37% der einheimischen Stromproduktion stammte 2023 aus Photovoltaikanlagen.
2023 speisten 2'899 Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung von 60'173 kWp elektrischen Strom ins Landesnetz ein.
Dies sind 15'151 kWp mehr als im Vorjahr. Im Jahr 2022 waren es 2'369 Anlagen.
Windenergie wird aktuell nicht produziert. Die Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW) prüfen derzeit geeignete Standorte.
Im Jahr 2023 wurden 1'150 GWh Energie genutzt, Tendenz sinkend.
Wichtigster Energieträger ist die Elektrizität mit einem Anteil von über einem Drittel.
Heizöl, Benzin und Diesel machen als zweite grosse Energiequelle fast 30% aus.
Energieträger in Liechtenstein
Die Elektrizität stellte 2023 mit einem Anteil von 34.9% den wichtigsten Energieträger dar.
Der Anteil der flüssigen fossilen Energieträger Benzin, Diesel und Heizöl erhöhte sich im Jahr 2023 von 27.8% auf 29.8%.
Was sind die Umweltauswirkungen der Energieproduktion?
Luftverschmutzung
Die Verbrennung von Öl, Gas und Kohle verursacht u.a. Feinstaub, Stickoxide und Schwefeldioxid, die zur Luftverschmutzung beitragen.
Klimawandel
Der Hauptverursacher der Treibhausgasemissionen ist die Verbrennung fossiler Brennstoffe.
Bei ihrer Verbrennung entstehen Treibhausgase, die die globale Erwärmung beschleunigen und weitreichende klimatische Veränderungen verursachen. Diese Veränderungen wirken sich auch auf die Biodiversität aus und bedrohen die Lebensräume zahlreicher Arten.
Umweltverschmutzung
Die Gewinnung und Verarbeitung fossiler Energieträger bringt zahlreiche Risiken für Wasser und Böden mit sich. Anbei einige Beispiele:
Bei Erdölverarbeitungsvorgängen besteht die Gefahr von Ölverschmutzungen von Gewässern oder Böden.
Der hohe Wasserverbrauch beispielsweise für die Kühlung von Kernkraftwerken beeinträchtigt lokale Wasserressourcen, während die Rückführung von erhitztem Wasser in Gewässer deren Ökosysteme stören kann.
Die Förderung fossiler Brennstoffe kann zu Chemikalienabfällen führen, die Grund- und Oberflächenwasser verschmutzen, beispielsweise beim Fracking.
Flächenverbrauch und Lebensraumzerstörung
Der Bau jeglicher Energieinfrastrukturen erfordert oft grosse Flächen und kann wertvolle Lebensräume zerstören oder fragmentieren.
Ein Beispiel: Wasserkraftwerke verändern die Fliessgewässer und beeinträchtigen die Wanderungen von Fischen und die natürliche Flussdynamik.
Abfall und Ressourcenverbrauch
Die Förderung und Nutzung fossiler sowie erneuerbarer Energieträger ist mit hohem Ressourcenverbrauch verbunden.
Auch Abfälle wie Rückstände aus der Kohleverbrennung müssen nachhaltig entsorgt werden, um langfristige Umweltauswirkungen zu minimieren.
Energietransport
Energie muss oft über weite Strecken transportiert werden, was Leitungsinfrastruktur und Pipelines erfordert.
Der Bau und Betrieb dieser Infrastrukturen kann ebenfalls Lebensräume zerschneiden und Umweltverschmutzungen verursachen, etwa bei Pipeline-Lecks.
Was unternimmt Liechtenstein im Bereich Energie?
Wärmedämmung der Gebäude (Neu- und Altbauten)
Ausbau der Nah- und Fernwärmeversorgung
Elektrifizierung der Busflotte des ÖV
Befreiung von E-Autos von der Motorfahrzeugsteuer
Förderung von Photovoltaikanlagen
Pumpspeicherwerk Samina als Tag-/Nachtspeicher und für den Leistungsausgleich
Strategische Gasreserve in Salzburg
Beteiligungen an Kraftwerken im Ausland (Wind- und Wasserkraft)
Energiestrategie 2030 / Energievision 2050
Die Energiestrategie 2030 basiert auf jener von 2020 und enthält konkrete Ziele und Massnahmen für die nächste Dekade, wie Liechtenstein in Sachen nachhaltiger Energie eine Vorbildrolle einnehmen kann und gleichzeitig die Versorgungssicherheit gewährleistet wird. Das Energieeffizienzgesetz und die -verordnung sowie weitere Gesetze bilden die gesetzliche Grundlage zur Strategie.
Die Energiestrategie 2030 zielt darauf ab, Liechtenstein auf den Weg zu einer umweltfreundlicheren und klimaneutralen Zukunft zu bringen. Ein Schwerpunkt der Strategie ist die Reduzierung des Energiebedarfs um 20%, was durch Effizienzverbesserung erreicht werden soll. Gleichzeitig wird der Anteil der erneuerbaren Energien auf 30% angehoben, mit dem Ziel, mindestens 17% dieser Energie im Inland zu erzeugen. Ausserdem strebt die Strategie eine Verringerung der CO2-Emissionen um 40% bis 2030 an, was einen wichtigen Schritt in Richtung einer klimafreundlichen und nachhaltigen Energieversorgung darstellt.
Weiterführende Informationen
energiebündel.li
Die Energiefachstelle energiebündel.li ist die zentrale Fachstelle des Landes für alle Fragen zur effizienten und umweltfreundlichen Nutzung von Energie sowie zur Förderung des Einsatzes von erneuerbaren Energien. Sie berät und unterstützt Private, Unternehmen und Institutionen auf dem Weg zur effizienten und erneuerbaren Energieversorgung.
Erstaunliche Fakten
In Liechtenstein macht der Sektor Energie rund 80% der Treibhausgasemissionen aus.
Der Ruhezustand bzw. Standby-Modus von elektronischen und elektrischen Geräten macht zwischen 5 und 80% ihres Stromverbrauchs aus. Wenn Geräte einen Transformator haben, der auf dem Netzkabel vor dem Ein/Aus-Schalter liegt, oder wenn gewisse ihrer Funktionen auf Batteriebasis weiterlaufen, verbrauchen sie umso mehr Strom im Standby.
Strom aus Kernenergie macht in Liechtenstein aktuell über 10% und in der Schweiz knapp 20% im Verbraucher-Strommix aus.